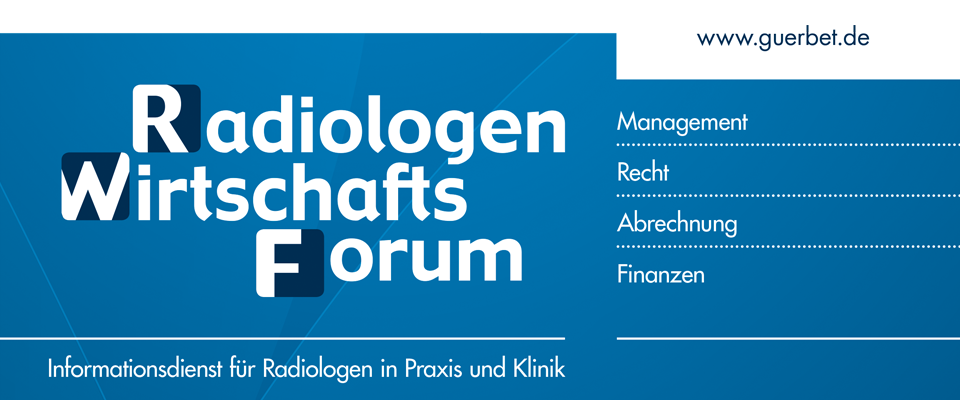Strategien und Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit in Praxis und Klinik (Teil 1)
von Dr. Bernd May, Geschäftsführer MBM Medical-Unternehmensberatung GmbH, Mainz
Üblicherweise wird eine Radiologin/ein Radiologe erst auf Anforderung einer klinischen Einrichtung tätig, seltener direkt durch den Patienten. Die anfordernde Einrichtung hat den Patienten untersucht und als Ergebnis eine Hypothese zur Diagnose bzw. zum klinischen Problem aufgestellt. Begleitet wird die Anforderung an die Radiologie mit einer Information zum klinischen Kontext. In Teil 1 des Beitrags geht es vor diesem Hintergrund um Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und dabei zunächst um die Optionen in einer radiologischen Praxis, also vor allem im Bereich der EBM-Abrechnungssystematik.
Abrechnung via DRG oder EBM
Im Vertragsarztwesen mit der EBM-Abrechnung handelt es sich bei der Anforderung um einen Auftrag, den die ambulante Radiologie erfüllt, und zwar unabhängig von der Qualität des klinischen Kontextes zur Hypothese/Diagnose. Losgelöst auch von der Qualität der Auftragserfüllung rechnet der niedergelassene Radiologe seine Leistung ab. Ganz anders in einer Klink mit den Fallpauschalen nach den „diagnosis related groups“ (DRG). In dieser „DRG-Welt“ wird der klinische Versorgungsprozess bezahlt, der anteilig die Kosten für die radiologische Versorgung enthält. Je früher und sicherer die Klinik-Radiologie dazu beiträgt, das Patientenproblem zu bestimmen, desto früher und gezielter kann eine Therapie beginnen mit der Chance für die Klinik, den Versorgungsprozess zur DRG-Vergütung rentabel abzurechnen.
Rechnung | ||
Beitrag der Radiologie zum Versorgungsprozess | Ergebnisqualität der radiologischen Behandlung | |
Kosten der radiologischen Behandlung | ||
Der Ergebnisbeitrag der Radiologie zum Versorgungsprozess lässt sich – vereinfacht – durch eine Formel darstellen (siehe Kasten „Rechnung“). Welche Strategien zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit lassen sich nun daraus in der „EBM-Welt“ (Praxis) bzw. in der „DRG-Welt“ (Klinik) ableiten? Betrachtet werden hier zunächst die Praxen.
EBM bietet wenig Spielraum
Grundsätzlich gibt es bei der EBM-Abrechnung wenig Spielraum für einen wirtschaftlich rentablen Betrieb der radiologischen Modalitäten Röntgen, CT oder MRT. So liegt die Gewinnschwelle für einen MRT-Betrieb zwischen 600.000 und 800.000 Euro p. a. unter Berücksichtigung aller Kosten (Investition, Personal, Energie und Opportunitätskosten). Bei einem – nach der EBM-Reform auf ca. 90 Euro abgeschmolzenen – durchschnittlichen MRT-Honorar (ohne KM) müssten also zum Erreichen der Gewinnschwelle zwischen 6.700 und 8.900 Kassenpatienten p. a. untersucht werden. Das sind an einem Acht-Stunden-Tag zwischen 27 und 35 Patienten und bedeutet eine Patientenwechselzeit zwischen 14 und 18 Minuten. Um das Ziel der Auftragserfüllung zu erreichen, muss der Radiologe bei den MRT-typischen langsamen Mess-Sequenzen den Aufwand für Messen, Patientenwechsel, Aufklärung, Befundung auf das erreichbare Minimum reduzieren. Dazu ist ein schneller Workflow mit schlanken Prozessen zu organisieren. Ziel sollte dabei sein, die Patientenwechselzeit, die Personalbindung und insbesondere die Arztbindung möglichst gering zu halten.
Die volle Konzentration sollte auf der Senkung der Kosten der Behandlung liegen, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Spielräume für die Qualität der Untersuchungen kommen in diesem System allerdings nicht vor. Das gilt auch für eine Überprüfung, inwieweit der klinische Kontext zur Hypothese/Diagnose für das Patientenproblem passt.
Merke |
An diesem Punkt, also der fehlenden Prüfung des klinischen Kontextes zur Hypothese/Diagnose und das Patientenproblem“ offenbart sich ein Systemfehler. In etwa 30 bis 40 Prozent der angeforderten Fälle trifft die Hypothese nicht das klinisch relevante Patientenproblem und der Radiologe erbringt in solchen Fällen, die er allein aus den hier dargestellten Zeitgründen nicht überprüfen kann, eine vom Kassensystem finanzierte Blindleistung. |
Die Industrie entwickelt ein immer reichhaltiger ausgestattetes Paket von KI-unterstützten Prozessbestandteilen wie z. B. bei der Patientenlagerung und insbesondere der Befundunterstützung (Covid-19 mit CT und Röntgen, Schlaganfalldiagnostik mit CT und MRT, MS-Diagnostik mit MRT, onkologische Diagnostik in Hirn, Prostata mit MRT, Lungen-CT u. a., die z. T. bereits als zugelassenes Produkt in Europa verfügbar sind). KI-gestützte Technologien zur Befundunterstützung helfen zwar dem einzelnen Arzt (Gewinn von Sicherheit, Zeit und Entwicklung einer individuell unabhängigen Befundsystematik), doch sie lösen das grundsätzliche Problem nicht, wenn die angeforderte radiologische Leistung aufgrund einer falschen Hypothese des anfordernden Arztes entsprechend durchgeführt wird.
Vier Optionen
Welche Möglichkeiten bleiben dem „EBM-Radiologen“ also zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit seines radiologischen Praxisbetriebs?
- 1. Mehr EBM-Patienten untersuchen; doch diese Option ist nur jenseits der Gewinnschwelle sinnvoll, wenn zudem personelle, apparative und Zeitkapazitäten zur Verfügung stehen.
- 2. Zusätzliche Privatpatienten akquirieren.
- 3. Kooperationen mit attraktiven Kliniken abschließen zur Übernahme der stationären Versorgung (frei verhandelbare Honorare für die Untersuchung der DRG-Patienten) und Versorgung der Privatpatienten der klinischen Abteilungen.
- 4. Verbünde/Ketten bilden mit den zuvor unter 2. und 3. genannten Kriterien (Privatpatienten akquirieren, Klinikkooperationen abschließen)
Ziel: Ergebnisqualität steigern
Die Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit lassen sich nur über die Verbesserung der Ergebnisqualität der radiologischen Untersuchungen umsetzen (Zähler der Formel in der Rechnung). Nur so kann der radiologische Partner sich als Problemlöser gegenüber der zuweisenden Einrichtung und vor allen Dingen dem Patienten qualifizieren. Diese Qualifizierung ist besonders bei Klinikkooperationen wichtig, aber auch bei der Akquisition von Privatpatienten
Kernelement und oberstes Ziel sollte es dabei sein, in gut ausgebildete Ärzte zu investieren (u. a. durch Fortbildungen), nach Möglichkeit organisiert in einem Team aus Spezialisten, die bestimmte Fachgebiete abdecken (z. B. muskuloskelettale Untersuchungen, neurologische, onkologische, kardiologische, Autoimmunerkrankungen und die Kinder- sowie interventionelle Radiologie etc.).
Merke |
Bei der ärztlichen Leitung ist auf eine systemische Redundanz zuachten, denn im Fall des Ausscheidens des einzigen ärztlichen Leiters kann das gesamte Konzept zusammenbrechen. Dies ist wesentlich für den Praxiswert. |
Darüber hinaus sollte der Radiologe in geeignete Geräteausstattung investieren wie z. B. 3 Tesla-MRT oder aktuelle 1,5 Tesla mit der Möglichkeit, jede aktuelle Fragestellung qualitativ begründet abarbeiten zu können (z. B. wirklich differenzierte Prostata- und keine Beckenuntersuchungen). Ferner muss die radiologische Praxis investieren in
- geeignete Mitarbeiter,
- Infrastruktur für die Patientenvorbereitung mit Wartezonen Verkehrszonen und Mitarbeiterräumen,
- eine die Prozesse unterstützende IT-Infrastruktur mit der Möglichkeit der Vernetzung mit zuweisenden Praxen und Kliniken (Patienten- und Zuweiserportal).
Die Kooperation mit Kliniken kann bei der Ausgestaltung als MVZ eine Klinikbeteiligung berücksichtigen (wenn es sich um eine interessante, bestandsfähige Klinik handelt). Eine solche Beiteiligung kann auch für die Zukunftsfähigkeit der Praxis von zentraler Bedeutung sein.
Im Falle einer Praxiskette ist auch die Vernetzung innerhalb der Kette mit den verschiedenen Spezialisten wichtig, sodass an jedem Praxisstandort ein virtuelles Expertenteam zur Verfügung steht (über ein Teleradiologieportal). Darüber hinaus ist in Praxisketten der mögliche Aufbau eines Managementteams ein wichtiger Vorteil. Ein solches Team sollte vor allem ärztlich geleitet werden und über einen Unterbau für kaufmännisches Controlling, technische Infrastruktur, bauliche Infrastruktur, Finanzen und Recht verfügen.
AGB und Datenschutz
AGB und Datenschutz
Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf dieser Website. Hier finden Sie unsere
>>AGB
und unsere
>>Datenschutzbestimmungen.
Impressum
Impressum
Guerbet GmbH
Otto-Volger-Straße 11,
65843 Sulzbach/Taunus
Telefon: 06196 762-0
www.guerbet.de
E-Mail: info@guerbet.de
Kontakt zur Redaktion
Kontakt zur Redaktion
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Berichterstattung haben, erreichen Sie uns über folgende E-Mail-Adresse: rwf@iww.de.
Produktinformation
Produktinformation
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu Produkten der Guerbet GmbH haben, kontaktieren Sie uns bitte hier.
>>Zum Kontaktformular